… und vor allem, was nicht!
Schon seit Jahren gehört das Gezeter um die Zukunft des klassischen Konzertes zum Betrieb. Dafür orientiert man sich auf Kongressen, dafür bringt man große empirische Studien auf den Weg. Publikumsforschung auf der einen Seite wird gepaart mit Musikvermittlungsversuchen auf der anderen Seite. Immer unter der Annahme, dass das klassische Konzert überholt sei.
Aber ist es das denn überhaupt? Es gibt viele Anzeichen dafür, dass der Besuch eine Konzertes oder eines Theaterstück, der Besuch eines Museums doch nicht so ganz seinen Reiz verloren hat. Denn, die Säle sind doch gar nicht so leer. Die Konzert- und Opernhäuser, die Theater und Museen freuen sich über regen Besuch und überbieten sich gegenseitig mit Auslastungszahlen. Was tatsächlich passiert ist doch eher, diese Landschaften werden Stück für Stück in der Republik abgebaut. Über die Jahre hinweg wird die Landschaft kleiner. Das liegt weniger an schlechten Besuchszahlen sondern eher daran, dass dieser Betrieb von jeher ein Zuschussbetrieb war und die Kassen der Kämmerer angeblich klamm sind. Der Betrieb ist teuer. Und er rentiert sich nicht, geht man von ökonomischen Kennziffern aus.
Dennoch wird um das Publikum gebuhlt: Das Konzert als bürgerliches Verhaltenstheater müsse sich ändern. Neue Publika müssen gewonnen werden, der Nachwuchs fehle. Wie geht das zusammen: Abbau auf der einen Seite und Neugewinnung auf der anderen?
Immer häufiger ruft man also dazu auf: Konzertformen zu ändern, man muss in Clubs gehen, in Industrieanlagen, raus aus dem Saal mit seiner Kleiderordnung, raus aus der zur zweiten Natur gewordenen Struktur. Und das wird als neues Rezept verkauft. Sieht man sich die Geschichte der Neuen Musik mal unter diesem Aspekt an, wird einem auffallen: Das wird schon längst gemacht, seit vielen Jahrzehnten. Die Musik passte sich neuen Medien immer wieder an, wie dem Rundfunk, dem Internet oder der Landschaft. Längst geht sie durch die Öffentlichkeit, sucht Orte auf, wo es weh tut. Und das passt auch. Es gehört zum Kunstwollen dieser Musik dazu. Es ist Bestandteil des künstlerisch-ästhetischen Konzepts. Akustische Klanginvasionen, Pilgerweg-Musik, Musik im öffentlichen Raum …
Aber es wird aus dem Geiste der Musik geboren, nicht aus dem Geist des Managements. Die vielen Formen musikalischer Konzepte sind längst unterwegs. Und das ändert nichts daran, dass ein filigran gearbeitetes Streichquartett eher nicht so gut auf einer Baustelle zur Geltung kommt, ein Tanz von Kränen allerdings schon.
Kurz gesagt: Für jeden musikalischen Zweck gibt es bessere und schlechtere Aufführungsbedingungen. Doch der Zweck liegt in der Musik, nicht im Publikum; das muss man nicht überreden, das muss sich finden. Da kann es nur heißen: Die Barrieren zwischen Hörern und Musik klein zu halten. Und wenn ein Publikum gerade eher vorm Monitor sitzt, freut es sich vielleicht, auch an diesem Platz Zugang zu finden. Anderes wird sich freuen, wenn es seiner Tradition folgen kann und im akustisch einwandfreien Konzertsaal ein Salonstück am Klavier hören kann 1– ohne Störung. So einfach ist das doch.
Hans Heinz Holz hat einmal, wenn man so will, den Vorteil der traditionellen Umgebung am Beispiel des Museums herausgestellt. Er schreibt in „Vom Kunstwerk zur Ware“ (Darmstadt 1973):
„In dieser Situation eines gestörten Verhältnisses von Künstler und Öffentlichkeit übernimmt das Museum eine hilfsweise vermittelnde Funktion. Von Institutionen der Öffentlichkeit getragen, öffentlich zugänglich und auf öffentliche Wirkung bedacht, holt es das Kunstwerk aus dem Marktmechanismus heraus in eine Sphäre, in der es nicht als Ware, sondern als Anschauungsobjekt (und damit als mögliches Medium der Reflexion) ausgestellt wird.“ (S. 121)
Darum, meine ich, ist der angeblich hilfreiche Vortrag von außen, nämlich dem des „managens“ um des „managens Willen“ wenig fruchtbar. Und wenn ich mich nicht täusche, gehen die musikalischen Institutionen häufig genug an die Plätze, wo sich Wichtiges ereignet (Kammerphilharmonie Bremen etc.). Nicht um zu retten, was verloren schien, sondern um dort zu wirken, wo man es will. Und ebenso die Komponisten: Ob Johannes Kreidler, ob Martin Schüttler, ob Maximilian Marcoll, ob Alois Späth … es gibt genügend. Zielten sie auf marktkonforme Musik, hießen sie eher Glanert, Widmann oder Rihm und würden auch so klingen – vielleicht besser, vielleicht schlechter. Aber es hat keinen Sinn, die Mittel der „Avantgarde“ zu kopieren und zu adaptieren, wenn die Inhalte ja doch ganz andere sind. Da kann man dann auch tiefgefrorenen Lachs als Speiseeis lutschen.
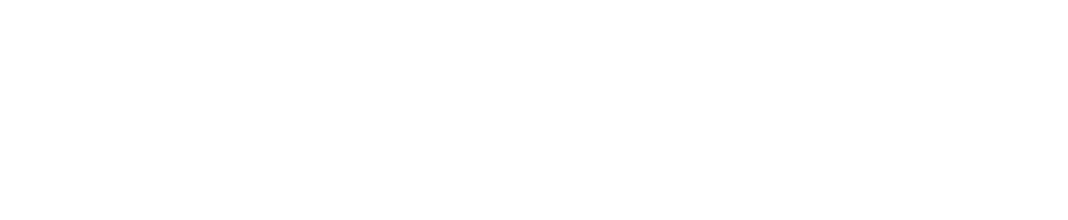

 RSS – Beiträge
RSS – Beiträge
5. Dezember 2014 um 12:32 Uhr
Die normale Konzertform ist nicht überholt… es ist der Mangel an Konzentrationswille bei jungen Menschen für klassische Musik der, ohne richtiges Unterricht, das Unverständniss verbreitet.