diagnosen und posen – klangsternhagelnuechtern
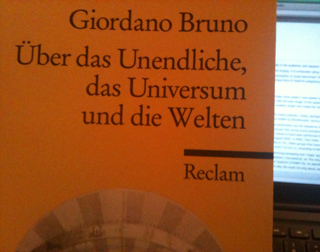
Ent-Zug. Diese Diagnose hat zuerst der Herausgeber einer bedeutenden Musikzeitschrift und Medienkleinunternehmer gestellt – sich selbst, nachdem er den Zug in Richtung heimatlicher Gefilde verlassen hat. Und ich muss sie uneingeschränkt auf mich anwenden: auch ich habe Ent-Zug. Zwei Tage habe ich die drei Anhänger und die bunte Lok nun schon nicht mehr gesehen: am Montag waren sie zur Waggonwellness im Depot und heute stand der D-Train in Göppingen und Leonberg, wo ich ihm nicht hingefolgt bin. Wass offenbar nicht schlau war, denn es war wohl viel los und eine tolle Atmosphäre – trotz Regens.
Grund für meine Abwesenheit in Leonberg war ein Beitrag für den BR, der heute, Mittwoch, um sieben in der Früh Bayern 4 Klassik läuft – reinhören, Kollege Hufner, hier wird das Tagesprogramm für Augsburg und Passau bekannt gegeben und Frau Barthelmes attestiert den Bayern einen anarchischen Charakter.
http://www.br-online.de/br-klassik/allegro/index.xml
Anlässlich der Produktion im SWR durfte ich auch noch lernen, was Programmaustausch wirklich heißt. Nicht etwa, wie vermutet, werden Inhalte ausgetauscht. Sondern man muss eine Menge über Software, vulgo: Programme reden, bis man so weit ist, dass sich das, was auf dem Papier und in Form von Rohmaterial existiert, sich zu einem smashigen Beitrag verbindet. Das ist wohl die Folge davon, wenn im SWR immer mehr Autoren und Redakteure selbst produzieren müssen und die Techniker nicht einmal mehr gescheites Arbeitsmaterial zur Verfügung haben…
Stuttgart war anders als die übrigen Stationen – nicht nur, weil die Aufführung von Sternklang klugerweise vorverlegt wurde. (Es blieb während der Parkmusik tatäschlich trocken, die ersten Tropfen fielen nach dem Schlussakkord und heute schüttete es in Strömen.) Stuttgart war bislang auch die einzige Station, in der das Geld nicht in Soundspaziergänge, Soundwalks, Klangpicknicks oder – auf diese Kreation erhebe ich den alleinigen Patentanspruch – „Klangwalks“ gestopft wurde, sondern mit Sternklang eine Komposition ausgewählt wurde, die zwar schon vierzig Jahre auf dem Buckel hat, die jedoch nicht mutwillig ins Draussen gestoßen wurde, sondern von vornherein dafür konzipiert war.
„Umsonst und draußen – das lockt die Schwaben“, kommentierte eine Stuttgarterin lakonisch mein Erstaunen darüber, dass trotz der Vorverlegung auf Montag so zahlreiche Menschen abends im Killesbergpark erschienen – und das obwohl K21-Demo war, was dann auch unter jüngeren Menschen bei der Begrüßung meist zuerst angesprochen wurde. „Hallo. Warst Du bei der Demo?“ – „Nein, Du?“ – „Ja klar, darum hab ich den Anfang verpasst…“ Nicht wenige der Älteren tragen einen grünen Button „obenbleiben“. Ich kann mich noch erinnern, dass in meiner Kindheit viele Menschen solche Schildchen trugen mit Aufschriften wie: „Atomkraft, nein danke.“ Kürzlich wurde ohne größeren Protest die Laufzeitverlängerung der Kraftwerke beschlossen.
Es dürften mindestens dreihundert Menschen gewesen sein, die sich zwischen den sechs Bühnen bewegten oder sich einen Sitzplatz suchten, um von einer Position aus das Geschehen zu verfolgen. Sagenhafte zweieinhalb Stunden dröhnt und murmelt, kuckuckt und synthetisiert die Musik vor sich hin. Zur originalen Aufführungspraxis fehlten im Publikum vermutlich ein paar Joints und zu bemängeln wäre wohl, dass die Musiker, die ihre Formeln und Figuren – begleitet von Fackelträgern – als Klanggabe zu ihren Freunden durch den Park trugen und jede Bühne einzeln damit ansteckten, aufgrund der Distanzen recht schnell laufen mussten, was der Intention des würdigen Schreitens mit gelegentlichem Blick zu den Sternen, den Stockhausen vorschreibt, nicht ganz entspricht. Vielleicht ist dies aber auch der einzige Weg, solchen Ideen die Peinlichkeit auszutreiben.
Wenn man – nach einigen Runden entlang der Bühnen, die man gedreht hat – sich auf einem Platz niederlässt und sich seiner Müdigkeit hingibt, kann einen diese Musik, die dann doch häufig aufs Allereinfachste, Elementarste rekurriert, ganz schön wegbeamen. Am Schönsten sind die Momente, wenn nach elektroakustisch verstärktem Obertongedöns eine einzelne Geige, ein einzelnes Akkordeon von fern herüberweht, sich durch den Park bewegt, dann erwacht das Gefühl der Erhabenheit – der bestirnte Himmel zeigt sich in seiner erschreckenden Größe, ich selbst bin nur ein verwehter Ton im Spätsommerwind.
Die letzte Passage meines Textes war ziemlich kitschig, was ich auch auf meinen Ent-Zug zurückführe. Schnell als Pose markieren. „Wer glaubt denn heute noch, dass jemand mit dem was er schreibt identisch wäre.“ So ähnlich hat Fritz J. Raddatz das schon in den 1980ern in seinen Tagebüchern formuliert, woraus ich Auszüge auf der Rückfahrt ins Rheinland – zurück? nach vorne? wer weiß es, wer will es wissen? – gelesen habe. Es gibt Menschen, denen ist dieses Geschreibe zu persönlich, es erscheint Ihnen zu privat. Doch ist Musikhören im Konzert ein privater Akt? Und ist es privat, wenn man sich darüber austauscht, was man gehört und empfunden hat? Oder ist es nur obszön, sobald man das auch hinschreibt?
„Das hat jetzt aber wirklich nichts mehr mit Sounding D zu tun, oder?“ Ich meine schon. Denn Autohupen als ästhetisches Erlebnis wahrnehmen zu können, ist das eine. Öffentlich eine Sprache für dieses intime Erleben zu finden, die andere. „Und wer nicht einmal Tränen geweint hat im Angesicht einer Rose oder eines Kunstwerks, ist der Kunst nicht würdig“, auch so etwas in vergleichbarem Zungenschlag konnte man bei Raddatz lesen. Er hat ja so recht. Das macht ihn so unerträglich.

http://www.br-online.de/bayern2/kulturwelt/sounding-d-musik-zug-musik-ID1283930057556.xml