Die Revolte einzelner Konzertbesucher in der Kölner Philharmonie gegen eine viertelstündiges Stück Minimal Music von Steve Reich hat in der Musikwelt zu zornigen Gegenreaktionen geführt. Wer nicht gleich (wie Axel Brüggemann in „Crescendo“) innerhalb eines Halbsatzes die Perspektive von den Kölner Konzertstörern hin zu AfD-nahen Flüchtlingsverjagern lenkte, prangerte wenigstens (wie Manuel Brug in der „Welt“ oder Moritz Eggert auf Facebook) zu Recht die rüpelhaften Manieren des Publikums an. Dennoch bleibt ein Staunen: Warum entzündete sich der Eklat, auf den der Cembalist Mahan Esfahani mit dem Abbruch des Stückes reagierte, ausgerecht an „Piano Phase“ von Steve Reich? Während Martin Hufner im Blog „Sperrsitz“ fragt, ob nicht auch der Einsatz elektronischer Mittel das Fass zum Überlaufen gebracht haben könnte, wundert sich Volker Hagedorn auf Zeit Online stellvertretend für alle: „H-Moll, du liebe Güte!“ (alle Links, siehe hier).
Hinter dem Erstaunen, dass ein 50 Jahre altes Musikstück Pöbeleien provoziert, die den großen Konzertskandalen von 1913 (Schönberg in Wien, Strawinsky in Paris) kaum nachstehen, steckt die Auffassung, dass das Neue Befremden nur so lange auslösen darf, wie es eben neu ist. In den über 10.000 Konzerten, die laut Deutscher Orchestervereinigung jährlich in Deutschland stattfinden, ist der Anteil an zeitgenössischer Musik hoch genug, als dass man einen Gewöhnungseffekt erwarten dürfte. Zumindest die Klassiker der Moderne und erst recht eine populäre Spielart der Neuen Musik wie die amerikanische Minimal Music sollten auch konservative Musikfreunde nicht mehr vom Stuhl hauen.
Das aber ist ein Irrtum.
Als das Alban Berg Quartett 1990/91 in seinen Zyklen des Wiener Konzerthauses alle sechs Bartók-Quartette auf das Programm setzte (wobei in drei Konzerten je zwei Bartóks einen Mozart umrahmten), reagierten viele Abonnenten mit Kündigung. Die beiden Zyklen im Mozart-Saal dürften die einzigen in der gloriosen Geschichte des Alban Berg Quartetts sein, für die an der Abendkasse noch Karten zu bekommen waren. Schönberg gilt für alles, was er nach der „Verklärten Nacht“ (1899) komponierte, als Kassengift; ein Orchestermanager, der eine Tournee mit den Variationen op. 31 anbieten wollte, sollte alternativ auch einen Schumann in der Tasche haben. Während sich der Erfinder der Zwölftontechnik sicher war, dass man nach einigen Jahrzehnten auch seine Musik gleich einem Ohrwurm pfeifen würde, pfeifen in Wahrheit weite Teile des Konzertpublikums selbst auf Werke, die bald 100 Jahre alt sind, oder hält sie als Mittelstück im berüchtigten Sandwich-Format (im Konzert wird das moderne Stück zwischen zwei Klassikern placiert) zähneknirschend aus. Wenn im Konzertprogramm einer Saison mehr Komponisten nach Mahler als vor ihm auftauchen, bezahlt man in der Regel mit Abonnentenrückgang. Schon wenn im einzelnen Konzert die Musik des 20. Jahrhunderts überwog, musste ich mich, ob Hamburg oder Heilbronn, vor stirnrunzelnden Zuhörern rechtfertigen. Sonntag-Nachmittag-Konzerte wie das in Köln sind das Refugium einer älteren, konservativen Publikumsschicht – daher die wütende Reaktion auf das Stück von Steve Reich, die sich zweifelsohne in der ersten Konzerthälfte bei den Werken von Fred Frith und Henryk Gorecki aufbaute.
Übertragungsdefekte
Die Hoffnung, dass die Toleranz gegenüber neuen Klängen nach wiederholter Begegnung mit diesen ansteige, mag der Hörbiografie der Programmmacher geschuldet sein – auf das Publikum übertragen lässt sie sich nicht. Dieses verspürt entweder Neugier oder lässt es bleiben. Und reagiert gereizt, wenn Erwartungen durchkreuzt werden. Allerdings, und hier kommt endlich die gute Nachricht, in beide Richtungen: Bei den Silvesterprogrammen des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg unter Ingo Metzmacher wussten die Besucher lediglich, dass sie ein Konzert lang Neues zu Gehör bekommen würden – die Konzerte standen unter dem Motto „Who Is Afraid Of 20th Century Music?“ –, und dennoch füllten sie die Hamburger Laeiszhalle, weil ihre Erwartung nicht enttäuscht wurde.
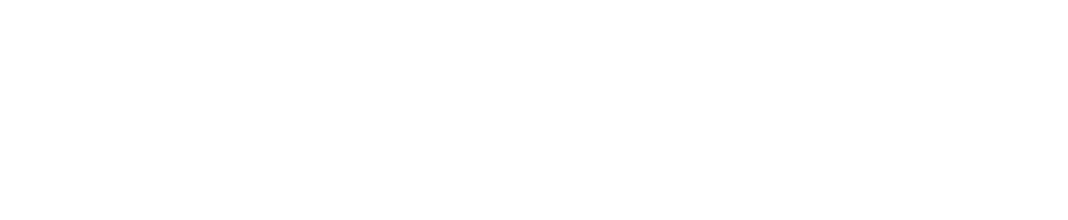

 RSS – Beiträge
RSS – Beiträge
8. März 2016 um 14:31 Uhr
Danke für diesen nüchternen Kommentar. Und was muss man daraus folgern? Gegen das Publikum lässt sich keine Programmpolitik machen, sonst kommt es einfach nicht mehr, oder es gibt einen Knall wie jetzt in Köln. Es ist eine Veranstalterfrage, auch wenn jetzt viele lieber das Publikum beschimpfen. Wem das Publikum nicht passt, kann ja zurück ins Neue-Musik-Getto. Dort herrscht der einheitliche Stallgeruch, und alle sind zufrieden.
Etwas bewegen lässt sich im allgemeinen Konzertleben nur, wenn man die Grenzen der Akzeptanz kennt und dort schrittweise etwas zu verändern versucht. Am einen Ort sind diese Grenzen relativ weit, am andern enger gefasst. Und ein Veranstalter kann durch intelligent geplante Aboreihen, Sonderkonzerte („Who is afraid“) etc. das am Neuen interessierte Publikum anlocken und andere zum Mitziehen motivieren. Vor 14 Jahren programmierte James Levine mit den Münchner Philharmonikern eine ganze Saison mit Beethoven und Schönberg. Es funktionierte, weil es dramaturgisch gut begründet war (im Hintergrund steckte als Berater auch Walter Levin). Aber an einem x-beliebigen Sonntagnachmittag dem ahnungslosen Publikum mit englischen Kommentaren einen Steve Reich verkaufen muss ja wohl daneben gehen. So kosmopolitisch sind auch in der Weltstadt Kölle nicht alle Leute, trotz WDR und Karneval.
8. März 2016 um 18:20 Uhr
Nyffeler’s Beschreibung der Neuen-Musikszene ist amüsant aber leider wahr:
„Dort herrscht der einheitliche Stallgeruch, und alle sind zufrieden.“ Das passt aber mehr auf Deutschland als auf anderen geografischen Bereichen.
Was immer wieder vom Blickpunkt der ’neuen-Musik-Professionals‘ unsichtbar, oder besser: unhörbar, scheint, ist den Uebermass an Dissonanz, und nur auf Klang basierte Werke die von einem auf dem grossen Repertoire gebildeten Publikum oft weniger musikalisch interessant und erregend sind als die ‚alte Musiksprache‘. Wer sich für eine Laufbahn in der neuen Musik entscheidet, studiert die konventionelle Musikgeschichte des 20. Jahrhundert, und erwerbt sich eine Wertenfassung die von der Tradition ganz verschieden ist. Dieser Abrgund wird oft ganz nicht wahrgenommen und die Ablehnungen des Publikums immer wieder als ‚konservativ‘ abgewertet: ‚man versteht es nicht‘. Aber was, als es möglich wäre, dass Ablehnung gerade auf Verständniss basiert ist? Auf eine instinktiv-korrekte Einsicht das ein neues Werk nicht den musikalischen Qualitäten, die man sich vergleichsweise eigengemacht hat, entspricht? Die ganze Problematik der neuen Musik, besonders in Deutschland, hätte dann ein anderes Gesicht.
8. März 2016 um 21:22 Uhr
Sie halten hier indirekt ein Plädoyer für eine museale Musikkultur, und das ist leider ebenso unfruchtbar wie die Mentalität derjenigen, die sich in ihrem Neue-Musik-Getto verschanzen möchten. Natürlich gibt es einen Bruch zwischen der tonalen Tradition und der Avantgarde des 20. Jh., und natürlich ist die Höhe der klassischen Musik für uns nicht mehr zu erreichen. Aber ich vermute, der kulturelle Bruch wird irgendwann auch einmal Geschichte sein und wir lernen an der posttonalen Musik dasjenige zu schätzen, was wirklich hörenwert ist. In der Entwicklung der heutigen Musik gibt es Tendenzen, die diese Zweiteilung zumindest in Ansätzen obsolet erscheinen lassen, und sie haben nichts mit Anbiederung an die Dummies, oberflächlicher Verpoppung etc. zu tun. Wichtig ist, dass man das Publikum ernst nimmt, dann macht es auch bei exponierten Werken eher mit. Aber Schneckenhäuser, ob „links“ oder „rechts“ gewickelt, bringen nichts.
8. März 2016 um 22:24 Uhr
Interessantes und enthüllendes Kommentar. „…. ein Plädoyer für eine museale Musikkultur,“ Ist die zentrale Aufführungskultur tatsächlich eine museale Kultur? Nur weil das meiste Repertoire alt ist? Sind die immer wieder zu neues Leben eingeblasene Werke nur Museumstücke? Und ihr Publikum nur nostalgische Museumbesucher? Es scheint mir, dass diese, inzwischen konventionelle Auffassung des Repertoires das Ergebnis ist einer musikgeschichtlichen Auffassung, die die Zeit wie eine Linie betrachtet, von A zu B zu C usw. Aber die Aufführungskultur funktioniert nicht historisch, sondern ästhetisch: für die meiste seriöse Musikliebhaber sind die ‚alte‘ Werke gar nicht alt, sie sind nur ‚alt‘ in buchstäblichen Sinn aber in ihr Effekt völlig lebendig und gegenwärtig, das ist auch so für die Aufführenden. Für die heutige Aufführungspraxis ist die Vision von B.A. Zimmermann: ‚die Kugelform der Zeit‘, wo alles zusammen in einem Kontinuum schwebt, nicht historische, aber ästhetische, also: praktische Wirklichkeit. Wenn man mit Dirigenten oder Solisten spricht über ihre Arbeit, ist für sie die Musik etwas äusserst ‚heute‘, und die beste Musiker wollen ihre gegenwärtige Erfahrungen mit dem Publikum teilen. Also, der Praxis der zentralen Aufführungskultur entspricht gar nicht der historischen Zeitlinie, die eher als eine abstrakte Projektion betrachtet werden kann. Mit anderen Worten, es kann so sein dass es das Begriff ‚Museumskultur‘, im negativen Sinne, nur in den Geistern der Aussenseiter gibt, d.h. vom Standpunkt der neue-Musik-Szene betrachtet wo eine Nachkriegsideologie eine sehr historisierende Auffassung ausgeübt hat, besonders in Deutschland – das kann man verstehen.
„….. und natürlich ist die Höhe der klassischen Musik für uns nicht mehr zu erreichen.“ Könnte es nicht sein, dass diese zweite ‚Feststellung‘ mit der ersten zusammenhängt? Nämlich, wenn die zentrale Aufführungskultur als ein Museum betrachtet wird, im SInne eines Bereiches dass nichts mehr zu bieten hat, kann man darin keine Anregungen zur neuen Schöpfung mehr finden, und die Erben der grossen klassischen Tradition – die heutigen Deutschen, die sonst im Aufführungspraxis so besonders fähig und tüchtig sind – haben nur ein Neue-Musik-Getto um ihre schöpferische ‚Kräfte‘ zu pflegen, also in einem Bereich das sehr, sehr beschränkt ist. Man kann das als eine Selbstverstümmelung sehen.
Uebrigens, das Begriff ‚Museum‘ soll nicht nur als etwas herablassend gesehen werden: die grosse Museen der Welt sind inzwischen eine Art ‚Kathedralen‘ der ikonischen Kunst der Vergangenheit geworden, wo Besucher Stunden in eine Schlange stehen um sich in ‚alte‘ Kunst zu vergaffen. Und was soll man von der Leipziger Schule denken, eine neue Kunst die sich in ihrer ‚Sprache‘ an älteren, figurativen Kunst orientiert? Und – vergleichenderweise – von den gegenwärtigen Komponisten in anderen Ländern die sich wieder erfolgreich von Traditionen inspirieren lassen? (David Matthews, Nicolas Bacri, Karol Beffa) Alles unzeitgemässe Unsinn? Und soja, wer bestimmt was zeitgemäss ist und was nicht, und auf welchem Grund?
http://johnborstlap.com/germany-and-new-classical-music/
Und auch etwas auf Deutsch: http://johnborstlap.com/389-2/
8. März 2016 um 22:04 Uhr
„Kosmopolitisch“: Das hätte ich vielleicht deutlicher ausdrücken sollen als nur durch die Erwähnung des Karnevals, den ich natürlich auch als ein lokales – wenn auch sympathisches – Selbstbestätigungsritual aus dem 19. Jh. betrachte.
8. März 2016 um 20:51 Uhr
„Kosmopolitisch“, wie Herr Nyffeler meint, ist das Domdorf am Rhein nicht, sondern tut nur so, denn provinzialistische Selbstbeweihräucherung ist hier Trumpf. Gerade das heimattümelnde Kommerzsurrogat des „kölschen Karnevals“ ist eben kein Beleg für offenen Geist, sondern eher für den engen Horizont affirmativer Mentalität. Und vom WDR, der einst für couragierte Förderung von Experiment und Avantgarde stand, heute aber dem von kommerzieller Konkurrenz vorgegebenen Mainstream des Unmaßgeblichen hinterherläuft (sich übrigens eine Hörfunkdirektorin eben aus der Sphäre des privaten Dudelfunks leistet), sei hier gleich ganz geschwiegen. Das Abonnementpublikum wiederum will sich mit Kunst oder überhaupt irgendeiner über seinen Hochnasenhorizont hinausreichenden Gedanken mehrheitlich nicht auseinandersetzen- Kunst ist, Karl Kraus zu apostrophieren, „Ornament“, und die Künstler werden von einem wesentlichen Teil der Bourgeoisie kaum mehr geachtet als dereinst die Spaßmacher und Gaukler bei Hofe. Um es abzukürzen- es muß gewiß nicht alles „gefallen“- aber, ohne hier gleich Adorno zu bemühen: muß es das denn überhaupt? Irgendwie erinnert dieser kleine Kölner „Konzertskandal“ von ferne an einen großen Kölner Konzertkrawall, der sich 2016 zum 90. Male jährt: die Tumulte um die Uraufführung von Bela Bartoks Tanzpantomime „Der wunderbare Mandarin“ und das nicht zuletzt von entrüsteten Deutschtümlern erzwungene Aufführungsverbot durch OB Konrad Adenauer. Manches scheint sich in Köln auch in 90 Jahren doch recht gleichzubleiben.
8. März 2016 um 22:06 Uhr
Mein Satz zu „kosmopolitisch“ ist jetzt eins nach oben gerutscht, bezieht sich aber auf Ihren Kommentar. Sorry.
8. März 2016 um 22:21 Uhr
Tut mir leid, nochmals ein Nachtrag (habe zu früh auf Absenden geklickt): Das Wort „Ironie“ fehlt in meinem vorigen Kurzkommentar.
Der UA-SKandal des „Mandarin“, an den Sie dankenswerterweise erinnern, steht schon in einem merkwürdigen Widerspruch zur Rolle, die Köln in den 50er und 60er Jahren in der Musik (und noch in den 70ern in der bildenden Kunst) gespielt hat. Aber vielleicht ging das auch nur, weil es sich im geschützten Bereich des WDR abgespielt hat und die Leute an den entscheidenden Stellen die Hand darüber gehalten haben. (eine Vermutung)