Mit diesem Titel wandte sich heute der Musikpublizist Michael Rebhahn an seine Darmstädter Zuhörer. Wir haben da mit rein gehört, denn bei bald 50.000 von der GEMA vertretenen Komponisten in Deutschland kann ja nicht jeder erfolgreich sein. Wären es alle, müsste man Erfolg vielleicht neu definieren!
Vielleicht ist es aber auch schon etwas schwierig, zu ergründen, was als Erfolg zählt. Hören Sie sich den Vortrag an.
Sie werden enttäuscht sein. Es gibt nach einer ausführlichen Zitatstaffel des Philosophen Christoph Menke ein paar knackige Leitsätze. Aber Vorsicht. Sie sind sowohl ernst gemeint wie nicht ernst gemeint. Also, sie sind vor allem eines, gemeint wie gesagt. Es ist ein recht tiefes Ergründen verbunden damit. Also in Begriffen mehr oder minder aktueller philosophischer Theorie. Und das ist ja dann schon auch interessant. So sehr es bei der Bestimmung von Erfolg und Misserfolg um einfachste Dinge geht, so braucht man doch sozusagen den heißen Boden der „Diskurse“ und so, damit der Geist der Sinnfälligkeit umso besser hopsen kann.
Die Thesen selbst sind ja ziemlich trivial und in sich widersprüchlich. Was übrigens kein Schaden ist. Im Gegentum. Thesen müssen so!
- „Du sollst skeptisch sein.“
- „Du sollst streitlustig sein.“
- „Du sollst autonom sein.“
- „Du sollst weitblickend sein.“
- „Du sollst selbstsicher sein.“
- „Du sollst – zumindest ein wenig – stylish sein.“
Ergänzend. Im Gespräch nach dem Vortrag ging es dann viel um die Kuscheligkeit der neuen-musik-szene. Dass man ja eher nix schlimmes über einen Komponisten schreiben würde mit dem man beispielsweise gestern Abend noch lustig ein Bier getrunken hat. Das ist ein Teil des Problems. Die alte Arbeitsteilung zwischen Komponist und Kritiker ist hinfällig. Vielfach sind die Komponisten selbst Kritiker, dann aber eher kritische denen gegenüber, die andere ästhetische Ziele verfolgen, nicht aber zur eigenen Gruppe. Und die Kritiker werden immer häufiger zu Propagandisten von Gruppen, was sonst eher die Verleger und ihre Lektoren waren – man denke zurück an die 20er Jahre, wo Zeitschriften eben Verlagsprodukte waren: Der Anbruch (Universal Edition), Melos (Schott) oder „23“ (Zeitschrift der Künstler, herausgegeben von Willi Reich).
Kritische Neutralität
Nun ist es zwar auch vielleicht etwas naiv, trotzdem dem Kritiker eben doch eine neutrale Position zuzuordnen, die ihre Stärke daraus zu speisen hat, was sie in der Sache sieht. Mithin ist es eben schwierig, zu kuscheln. Aber auch schwierig, Kritik zu begründen. Es gibt aber Orte, wo man das denn doch versucht. Die Zeitschrift „Seiltanz“ geht zum Beispiel noch am ehesten in diese Richtung. Otfried Höffe hat dafür einmal den Begriff der „judikativen Kritik“ ins Feld geführt, als einen, jenseits von affirmativer oder negativer.
„Judikativ ist die wissenschaftlicher Textkritik, judikativ sind das Feuilleton und die politischen Kommentare. Selbst wenn man gern den Fehdehandschuh wirft und mit spitzer Feder polemisch wird, ist Kritiker nicht, wer Texte, Neuerscheinungen oder politische Ereignisse zu verurteilen pflegt, sondern sie in ihrer philologischen oder ästhetischen Qualität bzw. in ihrem politischen Gewicht zu bewerten versteht.“ (Otfried Höffe, Kategorische Rechtsprinzipien. Ein Kontrapunkt der Moderne, Frankfurt/M. 1990, S. 37)
Der Schlaf der Szene in Sachen Streitlust, den Rebhahn, wenn ich es richtig verstanden habe, in die ab-der-70er-Jahre legte, kann man freilich auch nicht so recht nachvollziehen. Die Streitlust war doch vor allem in den 80er Jahren extrem und sieht man sich die dickeren Bücher von Mahnkopf an, auch Ende der 90er und mittleren 00er Jahre stets präsent. Allerdings, eben nicht ausgehend von Rebhahn. Dessen Harvard-Vortrag hat aber Antworten in zahlreichen Publikationen ausgelöst. Er selbst schrieb seinen Worten eine gewisse Polemik zu. Da muss man sich aber doch nicht wundern, wenn dies nun auch in umgekehrter Richtung ebenso passiert.
Die Landschaft des Streits
Dennoch ist es kein Fehler, wenn doch eine so reichhaltige Publikationslandschaft hier existiert: Mit den Positionen, Musiktexte, Neue Zeitschrift für Musik, Seiltanz, Musik & Ästehtik und auch der neuen musikzeitung. Zumal es ja auch in den 90er Jahren Verluste zu vermelden gab (wie die musica, ein bisschen die Österreichische Zeitschrift für Musik). Denn der eigentlich schöne Nebeneffekt der gesellschaftlich-ökonomischen Unwichtigkeit der „neuen Musik“ ist, dass der Diskussions-Markt nicht von Firmen übernommen wird. Da schaue man mal nur in den Klassik- oder Jazzbereich zum Vergleich (Jazzakzente, Klassikakzente).
Marketing und so
Heute hat man da die gern aufgetischte Dissonanz um den „neuen konzeptualismus“, die aber mindestens ebenso wenig präsent ist wie jeder andere auch. Auch dieser Streit ist nur hintergründig ästhetischer Natur, sondern er ist einer der Aufmerksamkeitskultur hervorrufen will, der mithin Bedeutungshoheit und -macht erzeugen will und damit ist er eben vor allem ein Streit des Marketings im kleinen Segment. Was im Tonträgermarkt die Majors sind, sind hier die Minors – aber eben nicht weniger vehement.
PS: Der Schlaf des Schuhs gebiert …
Achja, die Komponisten. Für sie gilt eigentlich immer das einfache Prinzip des Erfolgs: Sie müssen Professoren werden, an einer Hochschule lehren. Dann sind sie erfolgreich gewesen. ;)
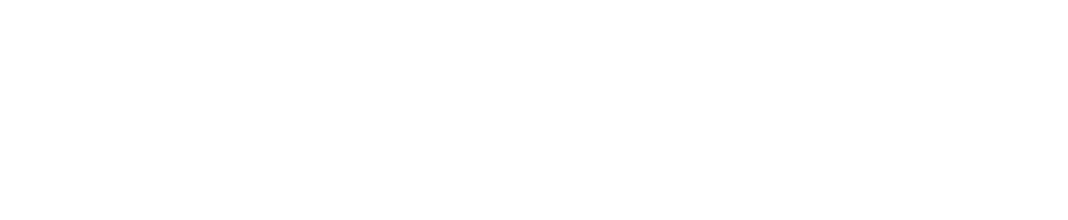

 RSS – Beiträge
RSS – Beiträge
11. August 2014 um 18:19 Uhr
Zum Thema Neue Musik und Kritik möchte ich einen schönen Ausspruch von Strawinsky zitieren (aus der DVD „Stravinsky in Hollywood“, C-major 716308, gerade erschienen):
„Die Kritiker können nicht über mich urteilen. Ich bin nicht nur bedeutender als sie, ich weiß es auch besser.“
Deshalb hatte er es auch nicht nötig, selbst den Kritiker zu spielen, um auf sich aufmerksam zu machen. :-D
11. August 2014 um 19:10 Uhr
Haha. Strawinsky ist gut. Ich meine, wenn man sich dann die Strawinsky-Parodie von Schoenberg ansieht, ist sie immerhin von einem Komponisten.
Aber mal anders und wieder ernster: Meiner Meinung nach sind Komponisten zum Beispiel überhaupt nicht geeignet, ihre eigenen Werke aufzuführen oder zu dirigieren. Sie sind vielleicht die bessren Komponisten und die besseren Kritiker, aber sind die schlechteren Interpreten …
11. August 2014 um 19:53 Uhr
Aber noch zu diesem Kurzreferat, das ich inzwischen gehört habe: Mir gefällt Rebhahns kurzweilige Polemik. Er formuliert geschliffen und setzt gute Pointen, das Ganze besitzt argumentative Leichtigkeit und luftige Ironie. Ein intellektueller Kolibri, der munter von einer Begriffsblüte zur anderen flattert und die angedrohte Problemlastigkeit in launige Kritikgirlanden auflöst. Ausnahmsweise mal keine theoretischen Verdauungsprobleme in Darm-Stadt, dafür einige durchaus ernsthafte Sticheleien gegen den musikalisch-gesellschaftlichen Status quo. Nach meinem Eindruck bleiben sie aber auf merkwürdige Weise in feuilletonistischer Unverbindlichkeit stecken. Ob es die wohltemperierte Atmosphäre dieses abgeschlossenen Avantgarde-Biotops ist, die eine in der Realität geerdete Kritik erschwert?
11. August 2014 um 20:16 Uhr
Vielleicht. Die Kritik der Kritik ist immer etwas, irgendwie, überflüssig. Unverbindlichkeit würde ich Rebhahn gerade nicht vorwerfen. Eher anders. Kann ich aber jetzt noch nicht verbalisieren. Müsste ich noch mal Martin Thruns Opus „Eigensinn und soziales Verhängnis – Erfahrung und Kultur ‚anderer Musik‘ im 20. Jahrhundert“ studieren. Mindestens die letzten 100 Seiten.
12. August 2014 um 12:36 Uhr
Dann wünsche ich gute Lektüre!
12. August 2014 um 13:00 Uhr
Danke.